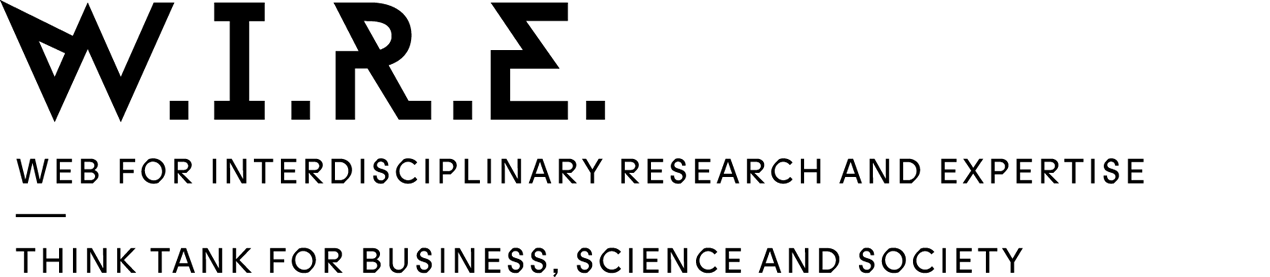Innovation fällt selten vom Himmel. Gespräch mit Harro von Senger
Der Sinologe Harro von Senger über Konfuzius, die Schlauheit der Chinesen und westliche Vorurteile
Von Simone Achermann
Die Internet-Piraterie blüht, und offene Innovationsmodelle erobern den Software-Markt. Wird das geistige Eigentum das 21. Jahrhundert überdauern?
Ja, doch es wird sich weiterentwickeln und nicht mehr nur vom westlichen Immaterialgüterrecht geprägt sein. Durch die Globalisierung ist das Interesse der Europäer an den Traditionen und Heilmitteln Afrikas und Asiens gewachsen. Deswegen sollen diese nun patentiert werden. So will Südafrika traditionelle Kunst, Folklore und heilkundliches Wissen rechtlich schützen lassen. Ähnlich die Volksrepublik China, wo man sich beklagt, dass Hollywood mit dem Film «Mulan» zwei Milliarden US-Dollar eingenommen hat, China – dessen Sage der Film erzählt – aber keinen Rappen. China wird sich in Zukunft auf internationaler und nationaler Ebene um den Schutz traditionellen chinesischen Wissens bemühen.
Gemäss «The Economist» stammen rund 70 Prozent aller Plagiate aus China. Warum wird gerade im Reich der Mitte so viel kopiert?
Obschon Schweizer Zollstatistiken von beschlagnahmten Waren diese Zahl bestätigen, ist sie dennoch irreführend. Denn es wird bei ihrer Berechnung nicht unterschieden zwischen Plagiaten, die man in China legal herstellen und verkaufen darf – weil die ausländischen Hersteller das geistige Eigentum an den Originalprodukten nicht schützen liessen – und Plagiaten, die in der Volksrepublik patentrechtlich geschützt sind. Plagiate der zweiten Kategorie dürfen in China weder hergestellt noch verkauft werden, doch die der ersten durchaus. So gesehen kopiert China zwar viel, aber nicht nur illegal. Übrigens war in den 1950er Jahren in der Schweiz die Migros bekannt dafür, dass sie kopierte: Auf den «Nescafé» reagierte sie mit «Zaun Kaffee», auf «Ovomaltine» mit «Eimalzin». Damit sich die deutsche «Bild»-Zeitung nicht auf die Schweiz ausdehnte, kopierte der Ringier-Verlag kurzerhand das Konzept und warf den «Blick» auf den Markt. Kopieren ist eine weltweit zu beobachtende Geschäftspraktik. Kaum hat ein Konkurrent etwas Neues auf den Markt gebracht, versucht man, ihm mit etwas Ähnlichem das Wasser abzugraben. Würde niemand kopieren, so gäbe es auf der Welt eine einzige Automarke.
Dann verwerfen Sie die gängige Behauptung, dass die Kopier-Kultur Chinas auf die konfuzianische Idealisierung der Nachahmung zurückzuführen sei?
Die Volksrepublik China ist ein marxistisch-leninistischer Staat. So wie man den Schutz des geistigen Eigentums in der EU nicht mit der Bibel begründen würde, so sollte man den Stellenwert des geistigen Eigentums in der Volksrepublik China nicht vom Konfuzianismus herleiten wollen. Von «Imitation» im konfuzianischen Weltbild zu sprechen ist übrigens fragwürdig. Was im alten China als Imitation daherkam, war in Wirklichkeit oft etwas Neues. Nur wurde das Neue durch Zitate aus konfuzianischen Werken verbrämt und als Imitat ausgegeben – weil die Berufung auf das «Alte» einer Aussage tatsächlich grosses Gewicht verlieh. Bekannt für die Verbreitung neuer Ideen unter einem konfuzianischen Deckmantel ist beispielsweise Kang Youwei, ein führender chinesischer Reformer des 19. Jahrhunderts. Er versuchte, gestützt auf Zitate aus einer alten konfuzianischen Schrift, die Gleichberechtigung von Frauen zu begründen. Nur bei ganz genauer Lektüre bemerkte man die Fälschung – was wie eine Kopie aussah, war keine Kopie. Auch gab es im alten China durchaus die Vorstellung von geistigem Eigentum, so in der Heilkunde oder in der Kampfkunst. Viele Heilkundige verfügten über Geheimrezepte, die sie beispielsweise nur ihrem Sohn anvertrauten. Meister bestimmter Kampfkünste suchten sich ebenfalls sorgfältig einen einzigen Schüler aus, dem sie ihre Kampfestricks weitergaben. Sogar die Seidenherstellung soll Jahrhunderte lang von Chinesen geheim gehalten worden sein, bis sie durch Spionage ins Ausland gelangte.
Sie sprechen in Ihrem Buch «Die Kunst der List» über die geschäftige Schlauheit der Chinesen. Soll der Westen davon lernen?
In dem Sinne, dass der Westen aufmerksamer wird und die chinesische Gesetzgebung besser studiert, ja. Denn die Volksrepublik profitiert vor allem von der Tatsache, dass viele europäische Unternehmen ihre Produkte in China nicht rechtlich absichern – dies obwohl es seit den Neunzigerjahren durchaus möglich ist, in China Markenzeichen und Patente schützen zu lassen. Kaum ein Westlicher
kennt sich im komplexen chinesischen Rechtssystem aus. Und so entdecken Vertreter von Schweizer Maschinenherstellern beim Besuch einer chinesischen Messe eine exakte Kopie ihrer Maschine, inklusive Schweizer Fabrikname, und jammern über chinesischen Technologieklau. In Tat und Wahrheit hat die Schweizer Firma ihre Hausaufgaben nicht gemacht, weil sie ihre Maschine in China nicht patent- und markenrechtlich geschützt hat. In China wurden also keine geistigen Eigentumsrechte verletzt – es wurde legal kopiert. Jede Firma, die sich mit dem Vorwurf der «Piraterie» in China beklagt, sollte also erst prüfen, ob sie ihre Marken und Patente dort hat schützen lassen. Listenblind rechnen viele Westliche nicht mit der Wachheit chinesischer Geschäftsleute, die geistesgegenwärtig jede Chance für einen Gewinn auszumünzen verstehen.
Jeder will eine gefälschte Louis Vuitton-Tasche und gratis Musik aus dem Internet, und dennoch wird die Piraterie weltweit verurteilt. Warum?
Weil es den Leuten an Rechtskenntnissen fehlt. Weder in der Volksrepublik China noch im Westen kennen sich die Durchschnittsbürger mit dem Immaterialgüterrecht aus. Daher verhalten sie sich in Bezug auf Fälschungen sorglos weil sachunkundig. Zudem verfallen viele dem Reiz der «Schnäppchen». Und teilweise zu Recht, weil viele sogenannte «Fälschungen» qualitativ gar nicht minderwertiger sind als die Originale. Ein bekannter Schweizer Jurist und ich besuchten vor einiger Zeit die Seidenstrasse in Peking. Mein Begleiter kaufte sich einen ganzen Stapel «gefälschter» Hemden, weil ihn die Qualität vor Jahren an demselben Ort gekaufter Hemden überzeugt hatte. Viele dieser Fälschungen waren auch nicht eigentliche Kopien sondern Markenware mit einem geringfügigen Mangel. Das Wort Fälschung ist also nicht automatisch mit schlechter Qualität gleichzusetzen.
Wie geschäftsschädigend ist Chinas landeseigene Piraterie? Der chinesische Software-Hersteller Kingsoft Corp. hat sich kürzlich beklagt, dass die Einnahmen für sein Chinesisch-Englisches Wörterbuch durch die chinesische Internet-Piraterie sabotiert wird.
Das Problem ist, dass über 90 Prozent der chinesischen Unternehmen über keine eigenen Patente verfügen. Zwar ist China die viertgrösste Volkswirtschaft der Welt, doch nur 0,3 Promille der chinesischen Unternehmen verfügen über Patente. Denn die Investitionen in die eigene Forschung und Entwicklung sind minimal. Den entwickelten Ländern und multinationalen Unternehmen wird vorgeworfen, die chinesische Entwicklung zu behindern, indem sie sich weigerten, Schlüsseltechnologien nach China zu exportieren. Die Technologien, welche noch eingeführt werden können, seien veraltert und führten wegen ihres grossen Energieverbrauchs zu Umweltschäden. Deshalb will sich China nun von seiner Importabhängigkeit loslösen und durch eigenständige Technologie sowie mittels einer 2008 verkündeten nationalen Strategie zum Schutz des geistigen Eigentums seine Zukunft sichern.
Der Politologe Martin Dimitrov behauptet allerdings, dass der chinesische Staat von der Produktpiraterie Chinas profitiert – durch aufwändige, von internationalen Firmen finanzierte Razzien auf chinesische Dörfer, die von der Fälschungsindustrie leben.
Weist Dimitrov denn nach, dass der Staat gezielt Produktpiraterie organisiert, um sich dann vom Ausland für deren
Bekämpfung bezahlen zu lassen? Ich denke kaum. Auch in der Schweiz oder in den USA ist die Einschaltung von Behörden zur Eindämmung von unrechtmässigen Handlungen kostenpflichtig. Ich gehe davon aus, dass es sich – wie so oft – um einen völlig normalen Sachverhalt handelt, der westlichen Menschen aber als merkwürdiges chinesisches Phänomen erscheint.
Was bedeutet für Sie Innovation heute?
Innovation fällt in der Regel nie vom Himmel und stellt selten etwas absolut Noch-nie-Dagewesenes dar. Vielmehr baut Neues sehr oft, wenn nicht meistens, auf Altem auf. Innovation ist dann also eine Kombination von etwas Bestehendem und etwas neu Erfundenem – im Westen wie in China, früher wie heute. Entgegen der Annahme, dass China nur Altes nachahmt, wird dort sogar der Erfindergeist von Kindern gefördert. So berichtete die «Chinesische Kinderzeitung» im letzen November von den Erfindungen 10- bis 12-jähriger Kinder. Darunter war die Idee einer Waschmaschine, die in die Laufgeräte von Fitnesscentern integriert und deren Waschtrommel durch das Laufen gedreht wird. So könne man mit sauberer, weil vom eigenen Körper erzeugter Energie, verschwitzte Leibchen waschen, kommentierten die Kinder.
Harro von Senger, geboren 1944, ist Schweizer Jurist und Sinologe. Auf seine rechtswissenschaftliche Promotion und Habilitation an der Universität Zürich wurde er nach langen Aufenthalten in Taiwan, der Volksrepublik China und Japan 1981 an der Universität Freiburg zum Dr. phil. promoviert. Ab 1981 war er Privatdozent für Sinologie an der Universität Zürich und von 1981 bis 1989 wissenschaftlicher Mitar-
beiter des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung in Lausanne. Von 1989 bis zu seiner Emeritierung 2009 hatte er eine Professur für Sinologie an der Albert-Ludwigs- Universität in Freiburg im Breisgau. Harro von Senger ist Verfasser von diversen Fachpublikationen, unter anderem «Supraplanung: Unerkannte Denkhorizonte aus dem Reich der Mitte» (München 2008) und «36 Strategeme für Manager» (München 2009), das erste westliche Buch über die 36 Strategeme der Chinesen. www.36strategeme.ch