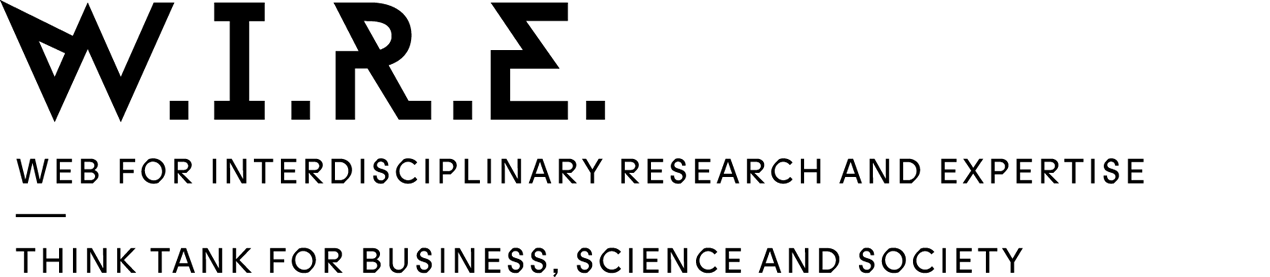Von Sex, Individualität und Tod. Essay von Gerd Folkers
Mensch und Sex gehören zusammen. Dies wird sich auch in Zeiten moderner Fortpflanzungstechnologie nicht ändern. Denn nur Sex garantiert die Fülle an Variationen, die unserer schwächlichen Spezies den evolutionären Vorsprung bringt.
Die Zeiten, in denen mein Geburtstag auf einen katholischen Feiertag fiel, der bei uns Mariä Verkündigung hiess, scheinen leider vorbei. Die «Verkündigung» hat sich kaum irgendwo als Feiertag halten können. Dafür mögen gute volkswirtschaftliche Gründe sprechen, vielleicht ist aber auch die Aufgeklärtheit – oder sollte man sie Abgeklärtheit nennen – der modernen Gesellschaft dafür verantwortlich. Die Jungfernzeugung kann man heute niemandem mehr ernsthaft verkaufen. Schon die Kleinsten spielen im Kindergarten unter dem wohlwollend wachen Auge des Gesetzes mit aufklärenden Puppen.
Wie üblich erweist sich aber die Abgeklärtheit durch Aufklärung als ein dünnes Brett. Eine unvoreingenommene Betrachtung der Vermehrungsriten im Königreich der belebten Natur enthüllt Jungfernzeugung und Jungfrauengeburt in grosser Zahl und vielfältigen Varianten von Fliegen und Echsen zu Truthähnen und Hammerhaien. Beim Menschen listet die Literatur zugegebenermassen nur einen einzigen Fall, was im Zeitalter des potenziellen Klonens womöglich aber bald schon zur Definitionssache wird. Denn natürlich haben wir Menschen von den Vorgängen um Zeugung und Empfängnis ein klassisch anthropozentrisches Weltbild zementiert: ohne Sex keine Nachkommen. Und Sex ist der Geschlechtsakt zwischen Mann und Frau, die Abgabe von Spermien, das Empfangen derselben und die darauffolgende Befruchtung eines bereitgehaltenen Eis, das sich zu einem hübschen Baby entwickelt und die Züge der Eltern trägt.
Welcher Sex für welche nachkommen?
Bei den Bienen zum Beispiel, deren Bestäubungsritual von Blumen allenthalben als Metapher für menschlichen Sex herhalten muss, stellt sich die Realität völlig anders dar. Die Königinnen haben die Fähigkeit, zwei ihrer haploiden1 Eizellen miteinander zu verschmelzen und somit ohne männliches Zutun diploide Nachkommen, logischerweise alles Töchter, zu zeugen, die allerdings kaum genetische Variationen aufweisen. Das ist für eine Thronfolge fein ausgedacht und hätte manches menschliche Herrscherhaus vor grösseren Schäden bewahrt.
Wie aber stimmt das mit der Evolution überein, die auf natürlicher Selektion und damit auf bester Anpassung beruht? Und Letztere vor allem darauf, dass sich bei der Vererbung etwas ändert und neue Merkmale entstehen?
Bei mehr als 200 Vogelarten und etwa 120 Säugerarten findet man soziale Strukturen, bei denen ein Teil der Individuen zumindest zeitweise auf eine eigene Repro
1 Haploid bezeichnet das Vorhandensein eines einfachen Satzes an Chromosomen in einer Zelle. Beim Menschen sind das 23 Stück (Frau: 22+x ; Mann: 22+y). Normale Körperzellen haben den doppelten Chromosomensatz (diploid), Geschlechtszellen den einfachen.
Bei mehr als 200 Vogelarten und etwa 120 Säugerarten findet man soziale Strukturen, bei denen ein Teil der Individuen zumindest zeitweise auf eine eigene Reproduktion verzichtet und stattdessen Artgenossen bei deren Reproduktion unterstützt. Dies steht in scheinbarem Widerspruch zu Darwins Thesen. Untersuchungen dieser Helfersysteme haben jedoch gezeigt, dass diese Hilfe meist umso stärker erfolgt, je näher die Helfer mit dem aufzuziehenden Nachwuchs verwandt sind. Da ein Teil des Genoms von Helfer und aufgezogenem Fremdnachwuchs identisch ist, erreicht der Helfer also trotz Verzichts auf eigene Reproduktion eine Weitergabe eines Teils seines Genoms. Bei Ameisen und sozialen Faltenwespen verzichtet der grösste Teil der Weibchen lebenslang auf eine eigene Fortpflanzung. Trotzdem sind diese evolutionär nicht weniger «fit», da sie aufgrund einer genetischen Besonderheit mit ihren Schwestern näher verwandt sind als mit potenziellen eigenen Nachkommen. Bei der Aufzucht von Schwestern geben sie also einen grösseren Teil ihres Genoms weiter als bei der Aufzucht eigener Töchter.
Genetische Betrachtungen sind von ihrer Umgebung nicht zu trennen. Bei Bienen und Ameisen verfügen sexuell reproduzierte Arbeiterinnen über genetische Varianten, die sich bei geänderter Umgebung durchsetzen, besser angepasst sind und in der feindlichen Umwelt weiterhin Nahrungsmittelbeschaffung und Nestbau erlauben. Im Inneren des Staats hat aber die Königin die Umgebung allein gestaltet. Zum einen, weil eine häufige genetische Variation ein stabiles Staatswesen gefährden würde. Zum andern, weil Fortpflanzung viel Energie benötigt. In einer möglichst konformen, einfachen Struktur im Inneren eines Nests kann enorm Energie durch konforme Nachkommen gespart werden. Ausserdem entfallen viel ärger und Lauferei bei der Suche nach geeigneten Sexualpartnern – eine weitere gewaltige Energieersparnis. Wachstum ist garantiert und die Ressourcen werden geschont. Warum machen wir Menschen das nicht? Sind die Insekten, viele Vögel und Säuger uns nicht weit überlegen?
Maximale Komplexität
Hier sei ein Gedanke eingebracht, der sich in der Evolutionsbiologie grosser Unbeliebtheit erfreut, nämlich derjenige der Ausnahmestellung des Homo sapiens sapiens. Damit ist nicht eine Stellung ausserhalb der biologischen Evolution gemeint, aber ein vorläufiger Kulminationspunkt. Die Fülle an menschlichen Varianten – an Individualität – ist übergross. Und die Kombination zahlreicher Fähigkeiten der einzelnen Individuen innerhalb einer Gemeinschaft zur Umsetzung von Lebensstrategien ist einzigartig. Damit ist eine bisher maximale Komplexität erreicht und es liegt nahe, dass genau dies eine der Triebkräfte der Evolution ist. Denn Systeme mit höchster Komplexität haben den Vorteil hoher Widerstandsfähigkeit, gepaart mit hoher Innovationsfähigkeit.
So ist der Mensch in seinen natürlichen Fertigkeiten oft zwar weit weniger gut als andere Exponenten der belebten Natur, aber er beherrscht als Spezies insgesamt viel mehr dieser Fertigkeiten. Das herausragende Merkmal ist die Ausdauer. Menschen sind schlechte, aber sehr ausdauernde Schwimmer, schlechte, aber sehr ausdauernde Läufer und Bergsteiger. Daneben Sänger, Kaufleute, Konstrukteure, Phantasten und Lügner. Sie können Pläne aushecken, verhandeln, täuschen und Fallen stellen. In alldem sind sie erfolgreich, weil sie ökonomisch und notwendigerweise kooperativ handeln. Das erfordert eine hochkomplexe Informationsverarbeitung. Die Evolution hat uns mit einem entsprechenden Körper und einem passenden Hirn ausgestattet und den aufrechten Gang ermöglicht. Dies wiederum bringt Sprachfähigkeit durch einen dem Gang angepassten Gaumen und Kehlkopf, selbst auf die Gefahr hin, beim Reden während des Essens zu ersticken – eine aus Ingenieurssicht unsinnige Konstruktion, die sich aber offensichtlich nicht als Selektionsmarker etabliert hat. Der aufrechte Gang ermöglicht uns auch Sex von Angesicht zu Angesicht und damit ganz neue soziale Strukturen, Verantwortungen, Tabus und Abhängigkeiten.
Die Erhaltung und Förderung dieser Individualität gelingt aber nur über Sex als geschlechtliche Reproduktion durch Träger möglichst komplementärer Eigenschaften innerhalb der gleichen Spezies. Da bleibt uns zwar noch die Wahl zwischen der althergebrachten geschlechtlichen Liebe und der modernen Medizinaltechnik, die durch künstliche Befruchtung genauso einen chromosomalen Austausch von Vater und Mutter vorbereitet. Beides ist aber sexuelle Fortpflanzung. Und nur sie garantiert Vielfalt.
Allerdings ist die sexuelle Fortpflanzung – und mit ihr die grösstmögliche Individualität – zu einem teuren Preis erkauft worden: dem Preis des einprogrammierten Tods, wie ihn die amerikanische Biologin Lynn Margulis bezeichnete. Denn Tod, im Unterschied zu rein körperlichem Sterben, bedingt das Verschwinden eines Individuums. Nur zu individuell wahrnehmbaren und damit eindeutig zu benennenden Vertretern einer Spezies existieren auch einmalige Beziehungen. Also hinterlässt auch nur Individualität eine Lücke. Das Verschwinden eines Einzelnen als einem unter Hunderten identischen Nachkommen fällt nicht einmal auf. Menschliche Sexualität bringt das Gegenteil: hohe Individualität – aber eben immer auch den Tod.
Was bedeutet dies für die Möglichkeiten sexloser Fortpflanzung? Spielen wir das Gedankenexperiment durch. Nehmen wir an, mittels moderner Fortpflanzungsmedizin vermehren wir uns bald über Klonierung; künstlich erzeugte Mehrlinge sind die Regel, also eine Reihe identischer Kopien für jedes Individuum. Nur: Ist es dann noch ein Individuum? Wie soll es als solches erkannt werden? Und ist der biologische Verlust, der Tod einer identischen Kopie weniger relevant als der Verlust des Originals? Dieses wäre – die zeit seines Lebens gemachten Erfahrungen einmal ausgeklammert – ja auch wieder zu kopieren. Gibt es damit überhaupt noch ein Original, dem nachzutrauern wäre? Nein. Deshalb der Schluss aus dem Experiment: Sex, Individuum und Tod sind aufs Engste verknüpft – und werden dies auch bleiben.
Wie genau die Zukunft unserer sexuellen Fortpflanzung aber aussieht, ist natürlich unklar. Künstliche Befruchtung, Merkmalsselektion und genetische Reparatur im Embryo sind Dauerthemen politisch-ethisch-wissenschaftlicher Kommissionen. Übernimmt bald rationaler Technosex die geschlechtliche Liebe und fragmentiert – in typischer ökonomischer Optimierung – Liebe, Erotik, Sex und Zeugung in voneinander ausgeschlossene «Jobs»? Der Gedanke ist alt. Gutmeinende Sozialreformer schlugen schon in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts vor, sich für Liebe und Freundschaft eines Menschen zu bedienen, für Sex eine mit perfekten Robotern bestückte Institution aufzusuchen und für den Nachwuchs ein biologisches Forschungsinstitut mit angeschlossener Kinderklinik einzuschalten. Einsehbar, dass viel emotionaler Aufwand reduziert werden könnte und wir vielleicht einem glücklicheren, entspannteren Leben entgegensehen würden.
Lernfähigkeit ist gefragt
Eine Ökonomisierung der Fortpflanzung und der sozialen Gemeinschaft im Sinne eines Fordismus mit standardisierter Massenproduktion und -konsumation von Sex und Nachkommen setzt allerdings eine Kenntnis über die natürlichen Vorgänge der Evolution voraus, die wir schlicht nicht besitzen. Und die wir wohl über lange Zeit nicht besitzen werden. Zwei kleine Beispiele aus der Natur sollen unser Unverständnis illustrieren:
Bestimmte Eidechsenarten in der Wüste New Mexicos vermehren sich durch Parthenogenese. Keine Männchen erwünscht und für ausschliesslich weibliche Nachkommen kann frau hier selber sorgen. Die Beobachtung zeigt, dass trotzdem Werbung und Liebesspiel der Jungfernzeugung vorangehen müssen, um eine besonders erfreuliche Nachkommenschaft zu haben. Was heisst das? Epigenetische, also durch den Kontext mitbestimmte Regulation von glücklichen Nachkommen? Das zweite Beispiel betrifft menschliche Zwillingsgeburten. Ein ganzes indisches Dorf und weltweit einige wenige Grossfamilien verblüffen die Fachwelt durch fast ausschliessliche Zwillingsgeburten. Und zwar durch eineiige Zwillinge, menschliche Klone, biologisch gesprochen. Wenn diese Zwillingsgeburten in dieser Form und nicht statistisch verteilt auftreten, dann legt das den Schluss nahe, dass nach der Zeugung die Entwicklung eines eineiigen Zwillingspärchens genetisch reguliert ist. Denn im Mittel kommt weltweit nur eine Zwillingsgeburt auf 40 normale Geburten und weniger als die Hälfte sind eineiige Zwillinge. Nur eins zu hundert. Was heisst das? Sind homozygote Mehrlinge eine «Laune» oder eine «evolutionäre Strategie»?
In beiden Fällen ist unsere Lernfähigkeit gefordert. Das heisst, wir müssen uns von Ideologien, Tabus und anderen moralischen Zwängen so befreien, dass ein offener gesellschaftlicher Diskurs darüber möglich wird, was diese Beobachtungen bedeuten. Naturromantik ist ebenso fehl am Platz wie blinder Glaube an technologischen Fortschritt. Es ist unmöglich, den Menschen von der Natur zu distanzieren. Und dass Natur mit Kultur zu überlisten sei, ist ein Aberglaube. Bescheiden sollten wir begreifen, dass all unsere kulturelle Überlegenheit eine simple Emergenz der Evolution ist, die dauernd weitergeht. Jeder kulturtechnische Eingriff in sexuelle Fortpflanzung löst als Reaktion ein kompensatorisches Geschehen an Orten und Zeiten aus, die wir nicht kennen. Da vertraue ich völlig den liberalen Ökonomen: Der Markt wirds schon richten, was nichts anderes heisst, als dass mit zu geringem Augenmass die Menschen zu den Kollateralschäden gehören könnten. Bei aller Schelte auf die Sozialwissenschaften, Geschichte und Psychologie, uns selbst erforschen wir immer noch viel zu wenig. Ob wir Bedeutungen für «Sex, sans Sex» finden oder sogar Handlungsanweisungen daraus erschliessen könnten, ist offen. Das ist für die Evolution völlig ok.
Prof. Dr. Gerd Folkers wurde 1991 als Professor für Pharmazeutische Chemie an die ETH Zürich gewählt. Er ist Mitglied des nationalen Forschungsrats der Schweiz und Geschäftsleitungsmitglied verschiedener Start-up-Unternehmen. Seit 2004 leitet er das Collegium Helveticum als gemeinsame Institution der Universität und der ETH Zürich.