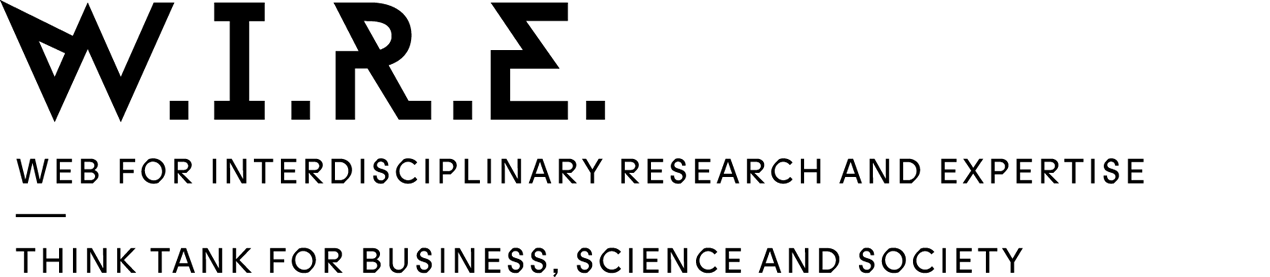In der Black Box. Gespräch mit Spencer Chainey
Von Hannes Grassegger
Hollywood-Filme wie «Minority Report» suggerieren, dass die Polizei künftig die Möglichkeit haben wird, Verbrechen vorherzusagen und Täter noch vor der geplanten Tat zu verhaften. Doch Spencer Chainey, einer der führenden Forscher im Feld datenbasierter Kriminalitätsvorhersage, glaubt nicht an solche Visionen. Polizeiarbeit werde auch in Zukunft auf der Fähigkeit zur Interpretation beruhen, sagt er. Und diese hätten Computer einfach nicht.
Herr Chainey, Sie beraten weltweit Regierungen zur vorausschauenden Überwachung – ein heiss diskutiertes Feld. Man hat den Eindruck, da würde an Techniken gearbeitet, mit denen die Polizei vorhersagen kann, wer wann welches Verbrechen begehen wird. Skeptiker fürchten bereits, die Freiheit des Geistes sei bedroht. Sind Sie wirklich in der Lage, Verbrechen vorherzusehen?
Es ist ein grundsätzliches Missverständnis anzunehmen, wir könnten etwas «vorhersehen», denn Predictive Policing, wie wir die vorausschauende Überwachung nennen, beruht auf der Auswertung von Informationsbeständen. Alle Tools, die derzeit in Benutzung sind oder von Softwarefirmen wie PredPol angeboten werden, beruhen auf historischen Daten, genau wie die Hotspot-Analyse. Predictive Policing hat einfach den Ruf angehängt bekommen, es könne in die Zukunft sehen – im Gegensatz zur HotspotAnalyse, meinem ursprünglichen Forschungsgebiet.
Hotspot-Analyse ist eine Technik, um Verbrechen mittels geografischer Informationssysteme zu lokalisieren und dadurch Muster zu erkennen. Wo liegt da die Verbindung zur Verbrechensvorhersage?
Wir entwickeln in der Hotspot-Analyse Wege, die Hochrisiko-Gegenden für spezifische Verbrechen identifizieren sollen: Hotspots eben. Im Kern ist das Verbrechensvorhersage. Denn in Wahrheit geht es bei der vorausschauenden Überwachung um Orte, nicht um Personen.
Wie genau funktioniert das?
Wir verarbeiten drei verschiedene Typen von Polizeidaten. Die wichtigste Quelle sind Aufzeichnungen von realen Verbrechen: Einbruch, Fahrraddiebstahl, geklaute Mobiltelefone. Die zweitwichtigste: Vorfälle oder Polizeimeldungen. Das sind nicht zwangsläufig Verbrechen, aber meistens steckt eines dahinter. Ein Beispiel: Sie sehen eine Massenschlägerei vor einem Fast-Food-Restaurant ausbrechen, morgens um eins. Sie rufen die Polizei, aber wenn diese eintrifft, sind alle Schläger bereits verschwunden. Die dritte Datenquelle sind Ergebnisse von eigenen Erhebungen, also wenn die Polizei Sie anhält und durchsucht. Allerdings muss man verstehen, dass man diese Daten nicht einfach steril analysieren kann, sondern sie einbetten muss in ein viel grösseres Bild. Dabei kommen sogenannte softe Informationen ins Spiel: Beobachtungen, Checks vor Ort, ein Gefühl für die Lage in gewissen Gegenden. Wie sehen die Leute aus, wie behandeln sie einander – all dies geben Polizisten in eine Verbrechensdatenbank ein, die die Informationen dann auf eine Karte projiziert. Das sieht aus wie Google Maps.
Das klingt eher nach alten Detektivfilmen als nach Science Fiction. Wie kommt man denn von da zur Vorhersage?
Durch etwas, das wir eigentlich schon immer wussten: Dort, wo grade eben ein Verbrechen passiert ist, findet mit hoher Wahrscheinlichkeit bald wieder eines statt. Wenn man also schaut, wo beispielsweise in den letzten drei Monaten Mobiltelefone geklaut wurden, dann hat man einen ganz guten Indikator dafür, wo das bald wieder geschehen wird.
Warum ist das so?
Die sogenannte Boost Account Theory behauptet, dies beruhe darauf, dass der Täter beim ersten Mal ungestraft davonkam. Wieso es also nicht wieder tun? Und er wird es am selben Ort versuchen, da er den Ort kennt, weiss, wie er dahin kommt und was für Schätze er beim ersten Mal zurückliess.
Und was ist dann Predictive Policing?
Der Begriff bezeichnet eigentlich primär neue Wege, wie Informationen ausgewertet und für Polizisten zusammengefasst werden. Im Crime Mapping, also dem Lokalisieren von Verbrechen, steckt seit jeher ein Element der Vorhersage. Nur ist in den letzten zwei Jahren dieses neue Schlagwort in Mode gekommen: Predictive Policing.
Es ist also nichts als ein Modewort? Es bezeichnet gar nichts wirklich Neuartiges?
Also ich persönlich finde nichts fundamental Neues daran. Es ist einfach ein neues Label. Das Einzige, was sich in jüngster Zeit wirklich verändert hat: Bis vor Kurzem mussten Polizisten ihre Analysten kontaktieren, um von ihnen Hotspot-Karten zu erhalten. Die gingen dann rum. Auf Papier oder per Mail. Heute haben die Polizisten spezialisierte Programme, deren Resultate als Karten angezeigt werden. Also braucht man weniger Analysten als früher. Der hauptsächliche Wandel liegt in der Verpackung.
Wir reden über Einbrüche und Fahrraddiebstähle. Wie sieht es mit der Vorhersage komplexerer Verbrechen aus, Finanzkriminalität beispielsweise?
Zurzeit ist die Mehrheit der Instrumente, die die Softwarefirmen zur Vorhersage liefern, auf Themen spezialisiert, die Polizeipatrouillen interessieren: Raub auf offener Strasse, Einbrüche in Geschäfte, Fahrzeugdiebstahl. Mir ist keine Software für so etwas wie Finanzkriminalität bekannt.
Nicht nur der Anwendungsbereich wäre ein anderer, sondern auch der Analyseansatz. Im Film «Minority Report» etwa konzentriert sich Verbrechensvorhersage auf Verhaltensanalysen, um zukünftige Handlungen von Personen vorherzusehen.
Predictive Policing konzentriert sich nicht auf das Profiling. Es geht um das Identifizieren von Risikogegenden. Natürlich: Wenn die Polizei ein bestimmtes Thema aufgreifen wollte, dann könnten die Ergebnisse der Hotspot-Analyse verknüpft werden mit spezifischen Risikopersonen. Und die Polizei könnte sich dann entscheiden, ein Auge auf diese Leute zu haben, wenn sie beispielsweise in der Gegend patrouilliert. Gegenwärtig produziert Predictive Policing einfach ein Viereck, das sagt: «Hier sollten Ressourcen eingesetzt werden.» Doch diese Instrumente eignen sich nicht, um psychologische Komponenten einzubringen. Und sie können auch nicht sagen, was für eine Art von Ressourcen eingesetzt werden soll in diesen Vierecken. Ganz zu schweigen davon, in welcher Weise man einschreiten soll, um Verbrechen zu verhindern. Also ob mit Schutzhelm oder freundlichen Gesprächen.
Liegt das nicht vor allem an der begrenzten Datenlage? In naher Zukunft könnte der Polizei eine wahre Datenflut zur Verfügung stehen – aus öffentlichen Statistiken, Sensoren im Stadtraum oder Mobiltelefonen. Eröffnet das nicht ganz neue Perspektiven für die Verbrechensvorhersage?
Mir ist kein Beweis dafür bekannt, dass im Bereich der Verbrechensvorhersage mehr Daten zwangsläufig bessere Ergebnisse bringen. Mehr Daten zu haben, kann sogar leichter in die Irre führen. Lassen Sie mich das erklären: Manche Software-Anbieter klatschen 50 bis 100 verschiedene Variablen in ihre Algorithmen, diese Black Boxes, die sie «Predictive Policing Tools» nennen. Dabei verkennen sie klassischerweise, dass vielleicht die Hälfte der Variablen quasi dasselbe aussagt, da sie hoch korreliert zueinander sind. So entsteht Redundanz. Und das kann das ganze Modell nutzlos werden lassen.
Wieso sollte ein Modell nutzlos werden, nur weil es redundante Variablen enthält?
Wenn man zwei Variablen, die im Prinzip das Gleiche sind, in einem Vorhersagemodell aggregiert, um eine Risikosumme zu erhalten, läuft man Gefahr, das gesamte Risikoniveau zu überschätzen. Mehr vom Selben führt also zum Anhäufen des Schätzfehlers.
Es dreht sich also alles um die Qualität der Algorithmen?
Noch vor dem Algorithmus kommt es auf die theoretische Fundierung an, welche Variablen überhaupt ins Modell einfliessen. Was wir hier an der Universität im Verlauf vieler Forschungsjahre herausgefunden haben, ist, dass die beste Methode zur Verbrechensvorhersage wirklich ist, zu wissen, wo soeben ein Verbrechen begangen wurde. Wir haben Studien zu Einbrüchen gemacht und unsere Ergebnisse sind dieselben wie die von ähnlichen Studien rund um die Welt, von den USA über China bis hin zu Südafrika oder Neuseeland. Wenn Sie zum Opfer eines Verbrechens werden, dann haben Sie und Ihre Nachbarn ein sehr stark erhöhtes Risiko, gleich in den Tagen darauf noch einmal zum Opfer desselben Verbrechens zu werden. Innerhalb der folgenden zwei oder drei Wochen sinkt dieses Risiko auf das durchschnittliche Niveau der Umgebung. Und das Risiko für Ihre Nachbarn sinkt abhängig von der Nähe zum Verbrechensvorfall. Dieses Muster trifft auf sehr viele Arten von Kriminalität zu – vom Handydiebstahl bis hin zu komplexeren Verbrechen. Deshalb ist dies das Modell, das wir in unserem Departement nach wie vor nutzen, um Verbrechen vorherzusagen.
Und was ist, wenn der Polizist selber zu einem anderen Schluss kommt als sein Computermodell?
Also wenn ich ein diensthabender Polizist wäre und es mir darum ginge, Verbrechen zu verhindern, dann würde ich mich auf eine Kombination von zwei Faktoren stützen. Einerseits eine solide Software, die mir hilft, gegenwärtige und zukünftige Risikogegenden zu identifizieren. Und dann würde ich zusätzliche Kontextinformation einbringen, aus meiner eigenen Erfahrung oder der meines Analyseteams. Und zwar um zu verstehen, was ich tun soll. Soll ich da jetzt mit Schutzweste rein oder versuchen zu reden? Sowas wird mir eine Maschine nie sagen können.
Aber wenn es sich doch im Kern um das Verstehen menschlichen Verhaltens dreht, sollte Predictive Policing dann nicht ganz darauf fokussieren, Individuen zu analysieren?
Nein. Ich finde, da wurden in der jüngeren Vergangenheit eine Menge Fehler gemacht. In den 1990er-Jahren liessen sich Polizeibeamte zur Erstellung von Verhaltensprofilen verführen. Sie hofften, einen Code zu finden, der ihnen sagen würde, «entsprechend diesem Verhaltensmuster ist es Herr Schmidt, der jenes Verbrechen begangen hat». Aber das klappte einfach nicht.
Warum funktioniert es denn nicht, über Algorithmen Verhalten vorherzusagen?
Es geht um den Kontext und dessen Interpretation. Um zu verstehen, was in einem bestimmten Fall wirklich vor sich gegangen ist, wird es immer einen Teil menschliche Interpretation brauchen – also auch bei der Vorhersage. Datengestützte Verbrechensvorhersage ist einfach ein Instrument, das uns unterstützt, das gute Polizeiarbeit aber niemals ersetzen kann.
Spencer Chainey ist Forschungsleiter des Departements für Sicherheitsforschung und Kriminalistik am University College of London. Sein Forschungsschwerpunkt ist das Crime Mapping, das Lokalisieren von Verbrechen. Er hat die Sicherheitspolitik Grossbritanniens sowie Verbrechensbekämpfungsprogramme in den USA, China, Deutschland und Südafrika mitgestaltet und ist Autor zahlreicher Sachbücher zu Predictive Policing. Er verfügt aber auch über Erfahrungen aus erster Hand. Bevor er in die Forschung kam, beschäftigte er sich jahrelang im öffentlichen und privaten Sektor sowie in Gemeinderegierungen mit der Verbrechensbekämpfung.