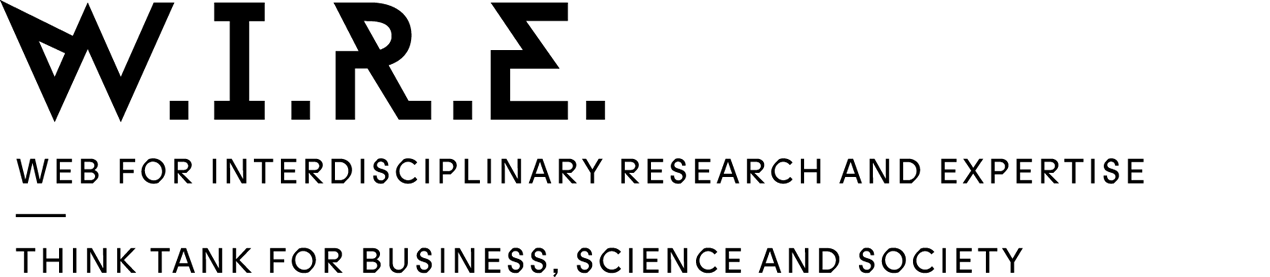Die Wiederentdeckung des Optimismus. Gespräch mit Steven Chu
Von Stephan Sigrist
Wenn wir den Klimawandel in den Griff bekommen möchten, wird Technologie eine zentrale Rolle spielen. Doch Politik und das Bildungswesen müssen die notwendigen Weichen stellen, um unser Konsumverhalten wieder auf wirkliche Bedürfnisse auszurichten. Der Physik-Nobelpreisträger und ehemalige Energieminister im Kabinett von Barack Obama, Steven Chu, ist überzeugt, dass Wissenschaft gepaart mit Verantwortungsgefühl und Optimismus die Langlebigkeit der Menschheit sichern kann.
Der Klimawandel ist eine der grössten Bedrohungen für die Langlebigkeit der Menschheit. Wie sieht in Ihren Augen der Weg in eine nachhaltigere Zukunft aus?
Wir brauchen bessere Technologien. Der Klimawandel ist meiner Meinung nach die grösste technische Herausforderung, der die Menschheit gegenübersteht. Doch wir sind auf gutem Weg. Elektromobile, beispielsweise, werden in zehn Jahren Mainstream sein, da sie dann in puncto Preis wie auch Leistung mit Verbrennungsmotoren mithalten können. Wir brauchen allerdings deutlich bessere Batterien als heute. Die des Tesla S-1 reicht für eine Entfernung von etwa 400 Kilometern, und mit einem schnellen Ladegerät kann sie innerhalb von 20 Minuten für 225 Kilometer geladen werden. Wenn die Reichweite ungefähr 500 Kilometer betragen wird und wir die Batterie eines 25000-Franken-Wagens innerhalb von fünf Minuten für 300 Kilometer laden können, werden Elektrofahrzeuge so attraktiv sein wie herkömmliche Autos. Weitere Faktoren, so etwa die wachsende Luftverschmutzung, werden sich ebenfalls begünstigend auf den Verkauf von Elektroautos auswirken.
Stellen wir uns die Welt in 20 Jahren vor: Werden wir über revolutionäre neue Technologien verfügen oder werden die Technologien, die wir bereits kennen, einfach effizienter sein?
Ein Grossteil der Innovationen ist evolutionärer Natur, aber nach einem halben Jahrhundert des Fortschritts erscheint die stetige Evolution wie eine Revolution. Die Verbesserung der Sonnen- und Windenergie oder auch von Batterien und Brennstoffzellen sind gute Beispiele hierfür. Eine Technologie, die für unsere Zukunft revolutionär sein könnte, ist die Fusionsenergie, die durch nukleare Verschmelzung gewonnen wird. Heute befindet sich die Methode allerdings noch im Stadium eines Experiments, und wir wissen nicht, ob wir diese Energiequelle jemals kommerziell nutzbar machen können. In der Zwischenzeit müssen wir uns auch darauf konzentrieren, bereits existierende Technologien wie etwa die herkömmliche Kernenergie zu optimieren.
Wie sieht die Zukunft der Kernenergie aus?
Vielleicht werden wir gegen Ende dieses Jahrhunderts keine nukleare Energie mehr brauchen, doch zurzeit sollte sie noch einen Teil unseres Grundlaststroms liefern. Nukleare Energie ist weniger bedenklich als die Verbrennung von Kohle, zumindest so, wie wir sie heute verbrennen. Auch China arbeitet verzweifelt an einer Verlagerung seiner Energieproduktion – weg von rein kohlegenerierter Elektrizität hin zu einer Mischung aus erneuerbarem, natürlichem Kraftstoff, Kernkraft und Kohle. Wie viel nukleare Energie wir in der nahen Zukunft brauchen werden, hängt von drei massgeblichen Faktoren ab. Erstens muss es uns gelingen, Kernkraftwerke um ein Vielfaches sicherer zu machen, sodass es selbst im Fall eines starken Erdbebens oder Tsunamis nicht zu einer Kernschmelze mit anschliessender Strahlenbelastung kommt. Zweitens müssen wir eine Lösung für die abgebrannten Brennelemente finden. Beide Herausforderungen sind technisch lösbar, wenn auch die zweite an eine ganze Reihe politischer Empfindlichkeiten gekoppelt ist. Schweden verzeichnet grosse Fortschritte bei der Planung und Gestaltung der Endlagerung nuklearer Abfälle und vor allem – dies ist eigentlich das Wichtigste – bei der Vertrauensbildung im Volk, dass das Abfallthema auf sichere Weise in den Griff zu bekommen ist. Der dritte Faktor ist die Gefahr durch Terrorismus. Kernkraftwerke müssen derart gut geschützt werden, dass sie von Terroristen nicht als potenzielle Ziele ins Visier genommen werden können.
Was braucht es neben der Technologie? Wenn Menschen das Rauchen aufgeben und damit ihre Gesundheit schützen, gelingt das durch eine Verhaltensänderung und nicht durch die Entwicklung gesünderer Zigaretten als Folge verbesserter Technologie.
Ich stimme Ihnen zu, dass Technologie nicht Lösungen für alle unsere Probleme liefern kann. In Bezug auf den Klimawandel sollten der Öffentlichkeit deshalb dessen erhebliche Risiken bewusst gemacht werden. Schulen, von der Grundschule bis zur Universität, spielen hierbei eine zentrale Rolle. Bildung kann auch Entscheidungen in Bezug auf den Lebensstil beeinflussen. In meiner Generation lechzten die Jungen noch nach einem Auto, das in fünf Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer beschleunigen kann.
Das ist auch mit einem Tesla noch möglich.
Richtig. Das letzte, leistungsstarke Model S braucht hierfür sogar nur 3,2 Sekunden. Doch auch wenn schnelle Wagen nach wie vor populär sind, entwickelt die junge Generation andere Vorlieben als jene, die meine Jugend prägten. Immer mehr Menschen wollen in Städten leben, aber kein Auto besitzen. Sie nutzen öffentliche Verkehrsmittel und je nach Bedarf Sharing-Plattformen wie Uber oder Zipcar. Sie wohnen lieber in einer kleinen Wohnung in der Stadt als in einem 250-Quadratmeter-Haus, für das sie jeden Tag zwei Stunden Pendeln in Kauf nehmen müssten. Sie ernähren sich viel bewusster und wollen nicht mehr ein- bis zweimal in der Woche ein 400-Gramm-Steak auf dem Teller haben. Diese jüngere Generation versteht, wie stark die Umwelt von unserem Lebensstil und unseren Werten beeinflusst wird. Technologie ist aber dennoch von Nutzen. Sie kann einen nachhaltigeren Lebensstil einfacher gestalten. Wenn wir «synthetisches» Fleisch, das wie echtes Fleisch schmeckt, direkt aus Nutzpflanzen gewinnen könnten, würde das die Belastung unseres Planeten stark reduzieren. Gleichzeitig sind Aufklärungskampagnen zu Nachhaltigkeit gefragt, um den Menschen dabei zu helfen, grosse, komplexe Langzeitherausforderungen in unserem Alltag anzugehen. Viele Leute sagen: «Was kann ich gegen den Klimawandel tun? Das ist solch ein grosses Problem, ich bin machtlos.» Das sind sie aber nicht: Sie können das Klima durch ihren Lebensstil beeinflussen und indirekt dadurch, für wen sie bei Wahlen stimmen.
Ihr Nobelpreisträger- und Physikprofessorkollege Professor Richard Ernst sagte, wahre Nachhaltigkeit beziehe sich auf die Zeitspanne von 1000 Jahren. Sind Sie mit der Aussage einverstanden?
Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit beeinflusst das, was wir tun, die Welt in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Das ist eine enorme Verantwortung, mit der wir umgehen lernen müssen. Vor 50 Jahren, als ich in der Highschool war, erwarteten alle, dass uns die malthusianische Katastrophe der Überbevölkerung letztendlich einholen würde. Man war überzeugt, dass jeder technologische Fortschritt, so etwa die Erfindung des Kunstdüngers oder die Grüne Revolution, uns lediglich etwas zeitlichen Aufschub beschert. Heute wächst der Optimismus wieder, da ein höherer Lebensstandard unter anderem zu einer tieferen Geburtenrate führt, was indirekt die Ressourcen schont. Es gibt kein physikalisches Gesetz, das besagt, dass nicht ein Grossteil der Weltbevölkerung eine Existenz in der Mittelschicht führen kann und gleichzeitig die Ressourcen der Erde verantwortungsvoll nutzt, sodass uns für viele Tausende von Jahren eine gut funktionierende Welt umgibt. Die Grundlage dafür sind bessere Technologien und der Wandel unseres Lebensstils.
Worin liegt die Verantwortung von Staaten und supranationalen Kollaborationen, wenn es darum geht, den Lebensstil zu verändern?
Die Regierungen sollten nicht nur die aktuelle Sicht der Industrie oder der Bevölkerung reflektieren. Sie selbst müssen zu Erziehern werden. Dasselbe gilt für Unternehmensführer. Die höchsten ethischen Business-Standards kommen von den Köpfen der Unternehmen, nicht von Angestellten im mittleren Kader. Die Leute werden den Visionen herausragender Führungspersönlichkeiten folgen.
Durch die zunehmende Komplexität wird es immer schwieriger, die Zukunft vorherzusehen. Sollten Regierungen dennoch Langzeitstrategien entwickeln oder brauchen sie vielmehr kurzfristige, flexible Lösungen für ein schrittweises Vorgehen?
Ich denke, es ist die zentrale Aufgabe von Regierungen, eine wissensbasierte Langzeitperspektive zu verfolgen und der Bevölkerung Ziele zu setzen, die über die nächste Wahl und sogar das nächste Jahrzehnt hinausreichen. Langzeitziele vor Augen zu haben ist für konstruktiven Wandel von grösster Bedeutung. Es ist schwierig, auf dem Weg zu bleiben, wenn man keinen Leitstern hat.
Sollten Unternehmen mutiger sein und ihr Geschäft mit Blick über die heutige Marktsituation hinaus betreiben?
Das wäre wünschenswert. Meist allerdings, wenn eine neue Technologie im Widerspruch zum aktuellen Geschäftsmodell steht, sind Unternehmen nicht offen dafür. So wird beispielsweise in vielen ländlichen Gegenden der Welt, die nicht an ein Stromnetz angeschlossen sind, Elektrizität durch die Verbrennung von – viel zu teurem – Diesel produziert. In letzter Zeit wurden Solarenergie und eine bescheidene Energiespeicherung zwar um ein Vielfaches preiswerter. Die Solarenergie wird aber immer noch primär für Mobiltelefone und LED-Beleuchtungen gebraucht, also für Geräte, die ihre benötigte Energie selbst speichern. Dabei wären Pumpen für Grundwasserförderung und die Reinigung des Wassers eine viel nützliche Art und Weise, die Elektrizität zu nutzen, denn es ist einfach, Wasser zu fördern, wenn die Sonne scheint. Und anschliessend lässt sich das saubere Wasser monatelang speichern. Sogar ein Kühlschrank, der gefrorenes Wasser als «thermische Batterie» nutzt, kann bei guter Isolierung mehr als einen Tag lang kühl gehalten werden. Die Kombination aus Solarenergie, Batteriespeicherung und einem Diesel-Backup für längere Perioden wäre wohl die beste Lösung. Das würde allerdings bedeuten, dass Menschen, die Dieselgeneratoren verkaufen, ihren Horizont erweitern müssen. Wenn jedoch die Person, die den Generator verkauft, auch Benzin anbietet, würde sie Solarenergie womöglich als Bedrohung ansehen und könnte geneigt sein, die Information zu verbreiten, Solarenergie sei unzuverlässig. Und so weiter.
Dennoch sind Sie optimistisch. Liegt es daran, dass Sie an die Wissenschaft glauben oder an die Menschheit?
Ich glaube an die Wissenschaft und an die Menschheit. Ich bin optimistisch, weil es inakzeptabel wäre, nicht mehr nach Lösungen für die Herausforderung des Klimawandels zu suchen und dafür, wie wir unseren Planeten für künftige Generationen retten können. Meiner Meinung nach ist es zutiefst unmoralisch, zu verleugnen, dass wir ein Problem haben.
Wenn Sie drei Wünsche hätten, um die Welt zu einem nachhaltigeren und besseren Ort zu machen: Welche wären das?
Als Erstes würde ich mir eine weltweite, möglichst ausschliessliche Verwendung preisgünstiger Energie aus erneuerbaren Quellen wünschen. Wenn man billige, saubere Energie hat, kann man auch das Frischwasser-Problem lösen, indem man Meerwasser entsalzt.
Als Zweites würde ich unser Problem der beiden Ressourcen fruchtbarer Boden und Mineralien angehen. Die richtige Kombination aus Energie, Landwirtschaft und Wassernutzung macht das Herz der Nachhaltigkeit aus.
Und als Drittes würde ich mir wünschen, dass sich unsere Erwartungen an entwickelte Volkswirtschaften ändern. Aufgrund der industriellen Revolution hat sich der Lebensstil in entwickelten Ländern in solch drastischer Weise verändert, wie sich das vor 200 Jahren niemand hätte träumen lassen. Der Anspruch auf ständig wachsenden Wohlstand war im letzten Jahrhundert die treibende Kraft vieler Nationen, doch wann wird dies enden? Die Frage ist: Wenn ich mir ein schickes Auto oder ein Ferienhaus leisten kann, sollte ich mir diese Dinge auch wirklich zulegen? Gandhi sagte: «Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.» Heute haben wir die Technologie, um immer mehr Auswüchse dieser Gier zu befriedigen, doch dabei saugen wir die Erde aus und verändern das Klima in eine sehr gefährliche Richtung. Wir sollten hart daran arbeiten, dass in 100 Jahren unsere heute noch ungeborenen Enkel uns nicht fragen werden: «Was haben sich unsere Grosseltern eigentlich gedacht? War ihnen egal, was aus uns werden wird?»
Steven Chu ist Nobelpreisträger der Physik und war von 2009 bis 2013 Energieminister im Kabinett von Barack Obama, wo er sich für eine nachhaltige Energiepolitik einsetzte. Als Professor an der Universität Standford und der UC Berkeley beschäftigt er sich mit physikalischer und quantenphysikalischer Grundlagenforschung bis hin zur Biotechnologie. Sein Fokus liegt in der Erforschung und Entwicklung leistungsstarker Energiespeicher.