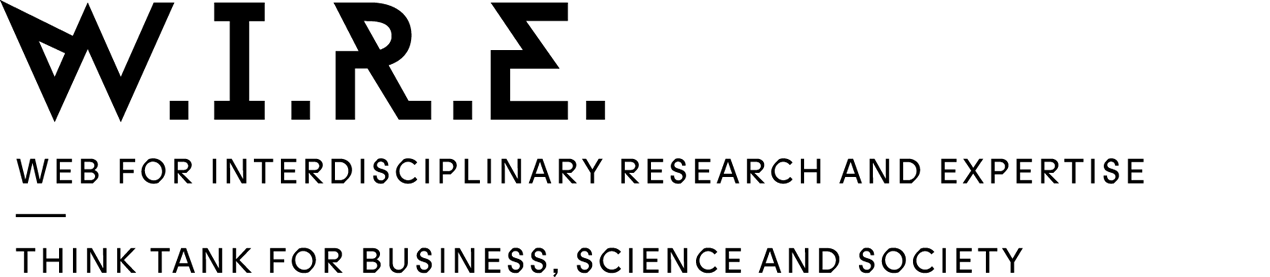Plastik ist der neue Diamant. Gespräch mit David de Rothschild
Von Michèle Wannaz
David de Rothschild ist bekannt als Abenteurer, der den Pazifik mit einem Boot aus gebrauchten Plastikflaschen überquert hat. Im Gespräch erklärt er, warum es beim Plastiki-Projekt nicht primär um Mut, sondern um die Umsetzung des Cradle-to-Cradle-Konzepts in die Praxis ging. Und dass Kunststoffe die Diamanten des 21. Jahrhunderts werden sollten, damit das Raumschiff Erde auf seiner Reise in die Zukunft überleben kann.
Vor zwei Jahren haben Sie gemeinsam mit einer Handvoll Designern und Biomimetikforschern Plastiki gebaut, einen aus 12 500 gebrauchten Plastikflaschen zusammengesetzten Katamaran, mit dem Sie dann den Pazifik überquerten. Betrachten Sie sich als einen Anhänger der Makerbewegung?
Zu Beginn des Projekts stand lediglich die Beobachtung, dass es vielen Menschen sehr schwer fällt, den im wesentlichen unsichtbaren Klimawandel – also beispielsweise die Menge an Kohlendioxid in unserer Atmosphäre – als Tatsache zu begreifen, während der Abfall einen sehr realen und greifbaren Fussabdruck hinterlässt. Mir wurde zunehmend klar, dass ein ökologisches Bewusstsein etwas Sichtbares und zum Anfassen braucht. Diese Erkenntnis brachte uns schliesslich auf den Prozess des Machens. Und natürlich auch die Tatsache, dass wir das Schiff von Grund auf selbst entwickeln mussten, da es noch nichts Vergleichbares gab.
Hat sich also die Botschaft des Projekts mit der Zeit verändert?
Ja und nein. Auf der einen Seite war die Genese von Plastiki eine Entdeckungsreise. Auf der anderen Seite hatten wir von Anfang an ein sehr klares Ziel vor Augen: die Cradle-to-Cradle-Philosophie zu propagieren. Es ging uns darum, die Leute für die Tatsache zu sensibilisieren, dass Materialien in geschlossenen, praktisch verlustfreien Kreisläufen zirkulieren sollten, als äquivalent zu den Nährstoffen in der Natur. Mich hat jedoch sehr enttäuscht, wie wenig die Medien auf die eigentliche Botschaft eingegangen sind. Sie fanden die Frage, ob unsere Bootsbesatzung überleben würde, viel interessanter als jene, wie das Projekt einen Beitrag zur Rettung der Welt leisten könnte. Tatsächlich passieren die aufregendsten Dinge des Plastiki-Projekts eigentlich erst jetzt, zwei Jahre nach unserer Reise. Beispielsweise arbeiten wir daran, aus unseren durch Plastiki gewonnenen Erkenntnissen ein Mainstreamprodukt zu entwickeln, das hoffentlich eine umwälzende Wirkung auf die Kunststoffindustrie haben wird. Leider darf ich Ihnen dazu aber noch nicht mehr verraten.
Viele Macher behaupten, Dinge herzustellen sei die beste Art, etwas über das Wesen der Welt zu lernen und deshalb die beste Voraussetzung für Innovation.
Das ist allerdings wahr. Ich musste immer lachen, wenn Leute sagten: «Aha, ich verstehe, Plastiki ist ein F&E(Forschungs- und Entwicklungs-)Projekt!» Ich erwiderte jeweils: «Nein, das ist nur ein E-Projekt. Und das E erzeugt das F.» Es sollte E &F heissen, nicht F &E. Denn wenn man etwas entwickelt, generiert man während des Herstellungsprozesses automatisch die Forschungsdaten, die dazu nötig sind – viel eher, als wenn ein Produkt theoretisch konzipiert wird. Innovation entsteht grösstenteils dort, wo man sie überhaupt nicht erwartet – sehr häufig übrigens durch Fehler, die oft zu den besten Lösungen führen.
Könnte sich der Trend zum Selbermachen nicht auch negativ auf die Umwelt auswirken, etwa, wenn wir in Zukunft jedes Produkt, das uns gefällt, einfach zuhause mit dem 3D-Drucker fabrizieren?
Natürlich könnte man argumentieren, dass die selbstständige Produktion von Alltagsgütern zu mehr Fehlern führt und in der Folge mehr Rohstoffe verbraucht als bei industriell hergestellten Produkten. Aber das existierende System ist derart unflexibel, sich an neue, bessere Technologien anzupassen und aufgrund der langen Transportwege so ineffizient, dass es einen deutlich schädlicheren Effekt auf unsere Umwelt hat als das horizontale, dezentrale Modell der bedarfsorientierten Just-in-time-Produktion, dessen Entstehung wir zurzeit beobachten. Wenn man exakt die Menge eines Produkts selbst produzieren kann, die man benötigt, ist man zudem nicht mehr gezwungen, Familienpackungen zu kaufen. Diese Vorteile machen die negativen Nebeneffekte der neuen Technologie mehr als wett. Entscheidend ist aber, dass wir die 3D-Drucker mit umweltfreundlichen Materialien füttern, um dem Cradle-to-Cradle-Prinzip einen Schritt näherzukommen.
Was kann sonst noch dabei helfen, das System der Natur besser zu imitieren?
Zuallererst müssen wir wirklich verstehen lernen, in welchem Masse wir von der Natur abhängig sind. Ich komme immer wieder auf ein Zitat von Buckminster Fuller aus dem Jahr 1963 zurück. Schon damals prophezeite er, dass wir unser Raumschiff Erde auf Dauer nicht erfolgreich betreiben können, wenn wir keinen Weg finden, mit den verfügbaren Ressourcen verantwortlich umzugehen. Er meinte damit die Menschen, ich meine damit die Natur. Denn wenn wir nicht lernen, die Natur als Fundament unseres Lebens zu begreifen, wird sich das Raumschiff mit allen Insassen selbst zerstören. Wir alle reden zwar von einer bevorstehenden Katastrophe, handeln aber nicht. Ein Grund dafür ist, dass wir in einer Art Schockstarre gefangen sind. Ich denke, das bekannte Modell zur Analyse von Leid und Trauer taugt auch sehr gut als Methodologie, um die Psychologie der Gesellschaft zu verstehen. Wenn wir jemanden verlieren, machen wir fünf Phasen durch – erst Zorn, dann Verleugnung, gefolgt von Verhandlung und Verzweiflung und schliesslich der Akzeptanz des Verlusts. Momentan stecken wir, und vor allem die Medien und die Politik, noch in den Phasen des Zorns und Nichtwahrhabenwollens der wissenschaftlich bewiesenen Bedrohung der Erde fest. Ein anderer Teil der Gesellschaft befindet sich bereits in der Verhandlungsphase. Er fragt: «Zu welchen Teilen ist der Klimawandel menschengemacht, zu welchen durch natürliche Entwicklungen verursacht? Vielleicht je zur Hälfte?» Allerdings ist diese Diskussion absurd. Die einzig relevante Frage lautet: Tod oder Leben?
Und wie können wir dieses Leben sichern?
Als Einzelner kann ich die Umweltzerstörung sicherlich nicht aufhalten. Die Probleme müssen systematisch angegangen werden. Als Gesellschaft sollten wir wie ein gesunder Organismus leben und von der Umwelt lernen. Das heisst, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz brauchen, einen das heutige, fragmentierte System überwindenden Wandel, der eine Harmonie zwischen Wirtschaft, Staat und Bürgern herstellt und eine spezifische Analyse der Ursachen und Wirkungen ermöglicht. Ein erster Schritt wäre es, mehr Plattformen zu entwickeln, auf denen sich Menschen aus unterschiedlichen Handlungsfeldern austauschen können. Diese könnten dann politische Regulierungen formulieren, Anreizsysteme für Unternehmen entwickeln und neue Bildungs- und Aufklärungskonzepte entwerfen.
Sind wir nicht bereits zur Genüge aufgeklärt? Zumindest theoretisch wissen wir doch, was zu tun ist.
Das bezweifle ich. Einige der gebildetsten Menschen, die ich getroffen habe, hatten in dieser Hinsicht die grössten Wissenslücken. Es ist erschreckend, wie viele Politiker und führende Wirtschaftsleute nicht wissen, dass wir jeden Tag 200 Arten verlieren, dass unsere Meere zu 80 Prozent ausgebeutet sind oder im Ozean eine Insel aus Plastikabfällen schwimmt, die so gross ist wie der Bundesstaat Texas. Sie haben keine Ahnung, welche schädlichen Auswirkungen ihre Politik und ihre Dienstleistungen tatsächlich haben. Und selbst wenn sie sie hätten: Es ist ein weiter Weg von der theoretischen Erkenntnis im Kopf zum Verständnis mit dem Herzen. Seltsamerweise identifizieren wir uns viel leichter mit Besitztümern als mit der Natur. Die Leute rasten völlig aus, wenn jemand ihr neues Auto zerbeult oder wenn sie ihr Mobiltelefon fallen lassen. Aber das sind bloss Formen der Natur, die von uns in Besitztümer verwandelt wurden. Dennoch fühlen wir uns persönlich weniger betroffen, wenn unsere Ozeane und Wälder zerstört werden.
Ist das Selbermachen eine Möglichkeit, die Menschen der Natur wieder näher zu bringen?
Definitiv. Die Makerbewegung schafft Transparenz. Dadurch, dass man etwas selber herstellt, beginnt man nicht nur zu verstehen, welche Materialien dazu benötigt werden, sondern auch, welch aufwändiger, ressourcenverbrauchender Prozess zu seiner Herstellung notwendig war. Und das kann einen zurück zum Ausgangspunkt bringen, zur Natur. Ausserdem haben Dinge einen grösseren emotionalen Wert, wenn man selber entschieden hat, wie sie aussehen und wozu sie gut sind. Das könnte das Ausmass der Verschwendung auf eindrucksvolle Weise reduzieren.
Das könnte auch Recycling. Viele Leute meinen jedoch, dies sei Energieverschwendung.
Und das stimmt auch. Theoretisch ist Recycling grossartig. Aber wir verfügen immer noch über sehr wenig Infrastruktur, um es auf die richtige Weise zu tun. Was Recycling betrifft, stecken wir noch in den Kinderschuhen – nicht zuletzt, weil es so starke Interessen seitens der Industrie gibt, die neue Güter produziert. Das Herauspressen von Rohstoffen und die Wiederaufbereitung von Gegenständen hinterlässt immer noch einen riesigen energetischen und chemischen Fussabdruck – um sie zu etwas zu recyceln, das oftmals von geringerer Qualität ist als das Ursprungsprodukt. Dieses sogenannte Downcycling ist vor allem bei Plastik ein gewaltiges Problem. Was wir also tun müssen, ist, die benutzten Materialien neu zu bewerten, insbesondere im Kunststoffbereich.
Wie können wir das erreichen?
Wir müssen eine andere Geschichte erzählen. Denken Sie nur an die Parallelen zwischen Diamanten und Plastik: Die Kunststoffindustrie wird von wenigen Konzernen kontrolliert, die Diamantenindustrie wird von wenigen Konzernen kontrolliert. Diamanten sind überall, Plastik ist überall. Beide halten ewig. Aber Plastik wird uns als wertloser Gegenstand präsentiert, den wir bedenkenlos wegschmeissen können. Diamanten dagegen sind von unschätzbarem Wert. Erstens, weil irgendwann ein Marketinggenie uns weisgemacht hat, sie seien ein Symbol der Ewigkeit und der Vermählung und jeder Verlobungsring solle deshalb ein Diamant sein – und zweitens, weil die Preise von Diamanten durch einen stark kontrollierten Markt künstlich hoch gehalten werden. Ihr Wert ist also fake. Ein Diamant ist bloss ein Stein, wie er sich überall finden lässt – und dem eine grossartige Story aufgedrückt wurde. Warum also tun wir nicht das Gleiche mit Plastik, um ihm mehr Wert zu verleihen?
Wir könnten den Status von Plastik auch erhöhen, indem wir neue Möglichkeiten des Upcyclings finden.
Genau. Wenn Plastik für bessere Zwecke wiederverwendet werden kann als zuvor, dann wird es automatisch einen höheren Wert haben. Nehmen Sie Aluminium als ein gutes Beispiel. Aus einer Aludose kann man das Rotorblatt eines Hubschraubers machen, also etwas mit einem deutlich höheren Wert. Und wie reagieren wir? Wir werfen sie nicht mehr so leichtfertig weg. So einfach ist das.
David de Rothschild ist ein britischer Abenteurer, Ökologe und Kopf der Adventure Ecology, einer Expeditionsgruppe mit Ziel der Sensibilisierung für den Klimawandel. Er entstammt der Bankiersfamilie Rothschild, studierte Politik und Informatik in Oxford sowie Naturheilkunde in London. 2010 überquerte er den Pazifik mit einem Floss aus Plastikflaschen und Recyclingmaterialien, um auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam zu machen.